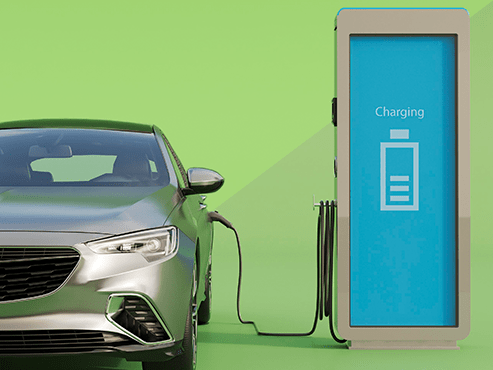Wer ein Elektroauto kauft, der kann viele Vorteile nur dann nutzen, wenn das Fahrzeug daheim geladen wird. Um das E-Auto zuhause zu laden, legen viele Hersteller einen sogenannten Notlader bei. Doch eignet sich der Stecker zum dauerhaften Laden oder wird eine Wallbox zwingend benötigt. Diese und weitere Fragen wollen wir in diesem Ratgeber beantworten.
Inhalt
- Wallbox oder Notlader?
- Wallbox für das Elektroauto
- Wallbox für Mietwohnungen
- Sonderfall: Mobile Wallboxen
- Gibt es noch das Förderprogramm für Wallboxen?
Wallbox oder Notlader?
Das Elektroauto an einer normalen Steckdose zu laden, scheint auf den ersten Blick eine einfache Lösung zu sein. Schließlich sind entsprechende Ladegeräte häufig im Lieferumfang der Fahrzeuge enthalten. Nicht umsonst wird das Kabel allerdings als Notladegerät bezeichnet: Die normalen Haushaltssteckdosen sind nicht als dauerhafte Ladelösung geeignet. Das liegt einerseits daran, dass die Ladedauer für die meisten Elektrofahrzeuge bei mehr als 24 Stunden liegt und damit nicht alltagstauglich ist. Die dauerhafte Belastung von Schuko-Steckdosen übersteigt außerdem deren Fähigkeiten und kann unter Umständen zu Hitzeentwicklung und schlussendlich zu Bränden führen. Bei Plug-in-Hybridfahrzeugen sieht die Sache etwas anders aus, da diese deutlich kleinere Akkus haben und schon nach zwei bis drei Stunden am Hausstrom vollgeladen werden können.
Wallbox für das Elektroauto
Schneller und sicherer geht das Laden des Autos daheim, wenn eine Wallbox verwendet wird. Durch speziell angepasste Technik schützt die Box Fahrzeug und Hausinstallation vor Überlastung und Fehlströmen und lädt deutlich effektiver (d.h. Ladeverluste werden im Vergleich zum Notlader minimiert) und schneller.
Funktionsweise von Wallboxen
Es handelt sich nicht um ein Ladegerät im klassischen Sinn, sondern um eine Steuerung für den Ladevorgang. Diese kommuniziert mit zwei Seiten: einerseits mit dem Auto, um den Ladevorgang optimal an den Bedarf anzupassen und andererseits mit dem Hausstrom, um Überlastungen zu verhindern. Die Vorteile sind vielfältig: So wird das Auto immer mit dem maximal möglichen Ladestrom und dadurch so schnell geladen, wie es möglich (und verträglich) ist. Nachfolgend ein Blick unter die Haube der Boxen, die viele technische Bauteile enthalten, um Sicherheit und Stabilität zu erhöhen.
Wallbox: Was steckt drin?
Ein FI-Schutzschalter sorgt dafür, dass bei Fehlern schnell abgeschaltet wird. Dieser arbeitet in Kombination mit dem sogenannten Installationsschütz, das den Stromfluss starten und unterbrechen kann (zum Beispiel, wenn die Phasenstromerkennung eine Überlastung erkennt). Um auch aus Richtung des Fahrzeugs gegen Fehlerströme abgesichert zu sein, ist ein DC-Fehlerstrommodul an Bord (DC steht für Gleichstrom, den sich das Fahrzeug aus dem angelieferten AC, also Wechselstrom, mit seinem Laderegler wandelt), kommt es hier zu einem Fehler, wird der Ladevorgang ebenfalls abgebrochen. Hinzu kommt in vielen Fällen ein Stromzähler, der eine genaue Verbrauchskontrolle ermöglicht und ggf. per WLAN mit einer zugehörigen App kommuniziert. Diese vernetzen intelligenten Wallboxen erlauben eine präzise Messung von Verbrauch und Ladeleistung. Dies wird durch das Backend gewährleistet, welches sich um die Auslesung der Daten kümmert. Abschließend sei der sogenannte Notfallkondensator zu erwähnen, der bei einem Stromausfall die Trennung des Kabels übernimmt, um das Abkoppeln in jedem Fall sicherzustellen. Diese technischen Bauteile finden sich in jeder Wallbox unabhängig von der möglichen Ladeleistung.
Die Leistung von Wallboxen
Bei Wallboxen für zuhause stehen mit 11 und 22 kW zwei unterschiedliche Leistungsstufen zur Verfügung. In den meisten Fällen lohnt sich die Anschaffung einer Wandladestation mit mehr als 11 kW nicht, da die Akkus der Fahrzeuge mit 22 kW auf Dauer stärker belastet werden und sich die verkürzte Ladezeit für daheim nicht lohnt. Hinzukommt, dass die weniger leistungsfähigen Ladepunkte zwar meldepflichtig, nicht aber genehmigungspflichtig sind. Melden sollten Sie den Einsatz einer entsprechenden Wallbox in jedem Fall, da die Stromanbieter auf diesem Weg die Netzbelastung besser einschätzen können.
Wallbox-Zusatzfunktionen
Wer den Ladepunkt an einer öffentlich zugänglichen Stelle betreibt, der wird sich über Sicherheitsfunktionen freuen, die eine Beschränkung des Zugangs erlauben. Ladeschlüssel oder Karten sind dann erforderlich, um den Ladevorgang zu starten. Die Karten bzw. Schlüssel haben einen weiteren Vorteil: Wird die Station von mehreren Mitgliedern eines Haushalts genutzt, lässt sich der Energieverbrauch zuordnen und gezielt abrechnen. Auch in Mietshäusern ein passendes Modell.
Wallbox für Mietwohnungen
Durch eine Änderung im Wohnungseigentumsgesetz (WEG), die im Dezember 2020 in Kraft tritt, haben es Mieter deutlich einfacher, eine Wallbox für ihren Parkplatz in der Tiefgarage zu bekommen. Ist ein fester Abstellort vorhanden, haben Vermieter keine Möglichkeit mehr, den Wunsch pauschal abzulehnen. Wichtig ist: angefragt werden muss auf jeden Fall. Einfach eine Box anzubringen, geht nicht.
Sonderfall: Mobile Wallboxen
Wer häufig unterwegs ist, jedoch Zugriff auf einen Anschluss mit Drehstrom (eine sogenannte CEE-Steckdose) hat, für den lohnt sich eine mobile Ladestation. Auch wer mit dem E-Auto in den Urlaub fährt, kann eine solche Lösung in Anspruch nehmen. Entsprechende Anbieter bieten auch Adapter an, mit denen sich länderspezifische Stecker verwenden lassen, um die Box zu betreiben. Auch wichtig: mit dem passenden Stecker können mobile Wallboxen zum Notlader werden, der sich mit dem normalen Haushaltsstrom verbinden lässt. Stellt sich abschließend noch die Frage, ob der Staat den Kauf bzw. die Installation einer entsprechenden Ladeeinrichtung weiterhin finanziell fördert.
Gibt es noch das Förderprogramm für Wallboxen?
Nein, die Förderung von Wallboxen durch die KfW ist ausgelaufen. Neben der Tatsache, dass der Fördertopf geleert worden ist, sprechen sinkende Preise der entsprechenden Technik gegen eine weitere Verlängerung der Fördergelder.